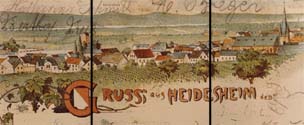
Historisches Heidesheim
seine Geschichte seine Kulturdenkmale seine Alltagskultur
 STARTSEITE |
| Heidesheimer Schenkungsurkunden  Einführung Schenkungsurkunden L Schenkungsurkunden W Hinweise zur Frühzeit Ausstellung |
| Impressum |
Ausstellung im Foyer der Verbandsgemeinde (26. Oktober 2011 - 26. Januar 2012)anlässlich der 1250-Jahrfeier von Heidesheim (762 - 2012)
Umfang und Wert der Schenkungen
|
|||
| Die Intention hinter den Zuwendungen an St. Nazarius war, mit einem spürbaren Opfer für das Heil der eigenen Seele oder fürbittend in dem Heiligen einen persönlichen Fürsprecher im Jenseits zu gewinnen oder sich das wirksame Gebet der Mönche zu sichern. | |||
| Umfang und Wert der Schenkungen entsprachen je nach persönlichem Besitz dem Anliegen der Geber und wurden großzügig bemessen. So umfassten die Schenkungen sogar ganze Hofgevierte einschließlich Nebengebäuden und fruchtbarem Ackerland. Erchenbert vermachte seinen gesamten Hof (mansum) nebst 60 Tagwerken (jurnales) besten Ackerlandes, Land, das ein Ochsengespann von Sonnenaufgang bis -untergang 60 lange Tage bearbeiten musste. Neben dieser terra aratoria, die durch jahrelanges Ackern zu dem fruchtbarsten Teil der Gemarkung gehörte, gehörten auch terrae arabiles, Ländereien, die gerade gerodet waren, zum Grundbestand zahlreicher Schenkungen. Nur 2 Mal gehörten kleine Wiesenparzellen dazu, deren Wert nicht nach der Fläche, sondern nach dem Ertrag (duas carradas = 2 Karren voll) bewertet wurden. Die wenigen Wiesenschenkungen wiesen darauf hin, dass das Wiesengelände innerhalb der Gemarkung nicht allzu groß war und die fränkischen Siedler mehr Wert auf Ackerland legten. | |||
|
|
|||
Gerätschaften |
|||
 An erster Stelle der
genannten Güter, die besonders geschätzt
wurden und den stetig wachsenden Reichtum des Klosters mit
begründeten, gehörte die große Zahl von
Weinlagen, ein
Indiz, dass Weinberge von der Frühzeit bis heute in Heidesheim
eine
besondere Rolle spielten und ursprünglich einen
größeren Teil der Gemarkung ausmachten als
heute.
|
 |
||
| Die Vermutung liegt nahe, dass die fränkischen Neusiedler vor Ort eine seit römischer Zeit bestehende Kultivierung von Wein vorfanden und weiter führten. Die auffallende Ähnlichkeit der verwendeten Werkzeuge von der Römerzeit bis in die Neuzeit unterstreicht diese (wahrscheinliche) Kontinuität. |  |
||
|
|
|||

|
Die Darstellung landwirtschaftlicher Arbeit aus einem Kalendarium zeigt neben den in den einzelnen Monaten anfallenden Tätigkeiten auch die gebräuchlichen Arbeitsgeräte wie Pflug, Sense oder Getreidesichel. Diese Werkzeuge und Geräte finden sich neben Gerätschaften aus dem Haus und Schmuck oder Waffen immer wieder als Grabbeigaben. | ||
| Mit den Franken erlebte die Landwirtschaft gegenüber der Römerzeit einen entscheidenden Wandel. Mit der Dreifelderwirtschaft wurde die Flur in 3 Teile gegliedert. Sommer- Wintersaat und Brache wechselten einander ab. Durch den ständigen Wechsel wurde jedem Drittel regelmäßig Zeit zur Ruhe gegeben. Im Frühjahr und Herbst wurden die Äcker bestellt, das Getreide erst im Winter gedroschen. Die regelmäßige Bewirtschaftung von Wiesen wie in den Augebieten des Rheins in Heidesheim war neu wie die damit verbundene eindeutige Abgrenzung zum fruchtbaren Ackerboden. |  |
||
  |
 |
 |
|
  |
  |
  |
|
Von den Franken übernommen, haben sich die Sicheln bis ins 19. Jahrhundert nur leicht verändert. Daneben haben Rodungsgeräte wie Pflugscharen verschiedener Größe die Zeiten seit dem Mittelalter überdauert. Im Unterschied zu den kleinen, glatten Rundsicheln für den Grasschnitt dienten die größeren und gezähnten Sicheln zum Ernten des Getreides, da sich das Stroh durch die Zähnung besser zu Bündeln/Garben raffen ließ. Die Sichel mit Holzgriff wurde noch um 1900 bei der Getreideernte eingesetzt. (Alle Objekte der Ausstellung stammen aus einer Heidesheimer Privatsammlung) |
|||
| weiter nach oben |
|||